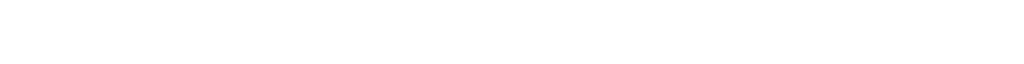Was macht man, wenn nix mehr geht? Macht nix, man geht weiter.
So ungefähr ist unsere erste Tour im Gebiet Arthur’s Pass kurz zu umschreiben.
Fange ich von vorne an.
Als fröhliche Gruppe von sieben Leuten, bestehend aus 2 Halb-Neuseeländern/Halb-Niederländern, einer Tschechin mit ihrem amerikanischen Freund, einem Vietnamesen, der in Neuseeland als einer von vier landesweit studiert, um Priester zu werden und zwei Urdeutschen zogen los, nach langer Zeit der Abstinenz körperlicher Ertüchtigung, eine Wandertour durch die Berge am Arthur’s Pass zu begehen.
Gut ausgestattet mit sämtlichen Übernachtungssachen war geplant, am ersten Tag den Avalanche Peak zu erklimmen, um am Mittag hoch oben auf ca. 1.800 m einen Lunch zu futtern. Anschließend sollte es um den Berg herum auf der anderen Seite wieder runter in das Crow-Tal gehen, wo wir die Nacht in einem Hut bleiben wollten.
Soweit geplant, so gut vorbereitet.
Nach ausführlicher Beschreibung und Einholung der Wettergegebenheiten auf dem Berg im zuständigen Visitor-Center des Arthur’s Pass ging es um 10.30 Uhr los.
Rauf, rauf, rauf – immer den Berg hinauf.
Nach den ersten 50 Höhenmetern war klar, dass es keine Wandertour, sondern eher eine Klettertour werden würde – und genau da ging es los, dass der Priester in spe schwächelte. Nicht dass es mir besser ging, allerdings war sein Problem ganz klar ein Krampf in mindestens einem Oberschenkel, wobei es sich bei mir eher auf die fehlende Kondition beschränkte und ich einfach nur langsamer wurde. Es ging trotzdem weiter ein Zurück war zu dem Zeitpunkt nicht denkbar.
Wer eine solche Tour mit der Mischung an Leuten, die nicht unterschiedlicher sein können, bereits einmal gemacht hat, der kann evtl. nachvollziehen, dass irgendwann nur noch das Team zählt und alles andere egal ist.
So wurde es egal, ob jemand langsamer oder schnell war – es war klar, dass wir alle zusammen oben ankommen wollten und dabei spielte es auch keine Rolle , wer mehr schwitzte, weniger Schmerzen hatte oder sogar kein Wasser mehr. Wer sich bergauf noch unterhalten konnte, der hat das Gepäck des Langsamsten getragen, Wasser wurde geteilt und mein Wanderstock wanderte schnell zum Priester, der zwar keinen Ton gesagt hat, aber unermessliche Schmerzen gehabt haben musste.
Um ca. 15 Uhr und nach 1.000 Höhenmetern haben wir dann alle zusammen den Peak erreicht, mit vielen Fotopausen.
Bei einem kurzen Lunch konnten wir Energie tanken und unsere Wunden lecken. Anschließend ging es weiter um den Berg herum; wie wir dachten…
Zur Beschreibung der Route gab es als Info einen Zettel mit Fotos, welche speziellen Wegpunkte wir nicht verpassen dürfen, da es weder eine Beschilderung noch eine Wegmarkierung gab.
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, absolut gruppenallein über eine Schneepassage zu laufen, ohne Steigeisen oder Spitzhacke. Also genau das zu machen, vor dem immer gewarnt wird… Über uns der spitze Gipfel mit Tonnen an Schneemassen und nach unten blickend ein Abhang mit einer Neigung von mindestens 80%.
Nachdem wir das erste Schneefeld überquert hatten, fand ich den Weg irgendwie komisch. Weitere drei Schneefelder folgten, die es zu überqueren galt.
Und dann standen wir da – um uns herum nur schneebedeckte Bergkuppen, Geröllhänge und weder ein Zeichen einer wichtigen Wegmarkierung, noch eine sichtbare Möglichkeit vom Bergkamm heruntersteigen zu können.
Was im Einzelnen in uns vorging ist nicht greifbar und auch die Beschreibung meiner Gedanken und Gefühle ist nicht dem Moment entsprechend. Es ist keine Wut über die falsche Navigation (denn das mitgeführte GPS hat den Weg richtig angesagt – aber man glaubt dem besser einfach nicht), ich hatte auch keine Angst, es war einfach alles leer an Gefühl oder Gedanken. Klar war, dass wir nun als Team noch mehr zählten und keiner seine eigene Tour durchziehen konnte, wir blieben zusammen. Der Jüngste von uns (19 Jahre) war nicht kaputt zu bekommen und fand sogar die Kraft, ein Schneefeld auf seinem Hintern hinunter zu rutschen.
Es war 16.30 Uhr und wir hatten nur noch ca. 3,5 Stunden Tageslicht – ganz klar nicht mehr ausreichend, um unser Ziel zu erreichen. Also gingen wir zurück zu unserem Lunch-Wegpunkt. Von dort aus war der Weg zumindest wieder zu unserem Startpunkt gekennzeichnet. Wir mussten uns nun entscheiden, den gleichen Weg wieder zurück zu gehen. Und das hieß, erneut 1.000 Höhenmeter hinab zu steigen.
Als passionierter Bergsteiger hat man meist kaum Respekt vor dem Aufstieg, denn dafür ist Kondition bereits ausreichend. Dagegen ist der Abstieg gleichzeitig auch wie der Tritt in die Hölle – die Schmerzhölle.
Neben dem eigenen Gewicht gilt es die Massen des Rucksacks abzufedern, einen sicheren Tritt im Geröll zu finden, wieder die vier Schneefelder zu überqueren und in mäßiger Hetze, den Berg mehr hinunter zu fallen als zu laufen.
Wer glaubt, dass runter schneller ist als rauf, der irrt sich gewaltig.
Die Höhenmeter, die beim Aufstieg nicht weniger werden wollten, die wurden ebenso beim Abstieg nicht geringer.
Gedanken des Aufgebens und des einfach Sitzenbleibens kommen auf. Beide Beine sind willendlich nicht mehr zu steuern geschweige denn zu fühlen. Ein kontrollierter Schritt ist nicht mehr möglich. Schlussendlich habe ich die Steuerung ganz alleine meinem Gehirn überlassen, in der Hoffnung, dass die jahrelange Übung des Laufens ohne großartiges Stolpern zu irgendwas gut war.
Wasser hatte ich bereits beim Aufstieg nach ca. 800 Höhenmetern nicht mehr, die 2 Liter waren schnell weg. Meine für den nächsten Tag geplante Frühstücks-Coke hat mich dann ansatzweise über einen absoluten Flüssigkeitmangel gerettet, den anderen war das Wasser inzwischen auch ausgegangen.
Diese absolut, zumindest navigationstechnisch, verbockte Tour endete nach genau 10 Stunden klettern, rauf und runter inkl. einer Viertelstunde Pause, 2,5 Litern Flüssigkeitzufuhr, mindestens 3 Litern Flüssigkeitverlust, Verlust der ersten Hautschichten beider Fersen, unbeschreiblich stinkend insgesamt und einem blutunterlaufenden linken Fußnagel. Den werde ich wohl verlieren –
Was ich gewonnen habe:
Kameraden, denen es ***egal ist, wer man ist und woher man kommt, Hauptsache der Spaßfaktor ist groß; den Zusammenhalt eines Teams, was internationaler und bunter nicht sein kann; das Vertrauen auf meinen Willen oder den Urtrieb, nicht aufgeben zu wollen; unbeschreibliche Eindrücke auf 1.800 m Höhe.